
Wir alle haben Klischees und Stereotype in unseren Köpfen. Das ist ganz normal und sogar hilfreich. Wichtig ist, dass wir uns unserer Stereotype bewusst werden – und wir somit entscheiden können, wie wir mit ihnen umgehen.
Neulich ist meine Schubladenfalle wieder zugeschnappt. Ich habe einen jungen Arzt für einen Praktikanten gehalten – wegen seines jugendlichen Aussehens. In meinem Kopf, so stelle ich es mir vor, lief das ungefähr so ab: Schublade auf, Vorurteil raus, an den Arzt gekoppelt, Schublade zu. Und dann, als die Situation geklärt war, kam das Erstaunen – und die Scham. Schließlich finde ich es selbst doof, dass ich des Öfteren wegen meines jugendlichen Aussehens geduzt, auf meine Körpergröße reduziert und unterschätzt werde.
Aber es ist nun mal so: Vorurteile sind in uns allen verhaftet – wir können sie nicht so einfach abstellen. Eigentlich sind Stereotype ja auch ganz hilfreich: Sie dienen unserer Orientierung in der Welt; sorgen dafür, dass wir nicht jedes Mal wieder aufs Neue eine Situation, einen Menschen oder eine Information einordnen und dafür Zeit und Energie investieren müssen.
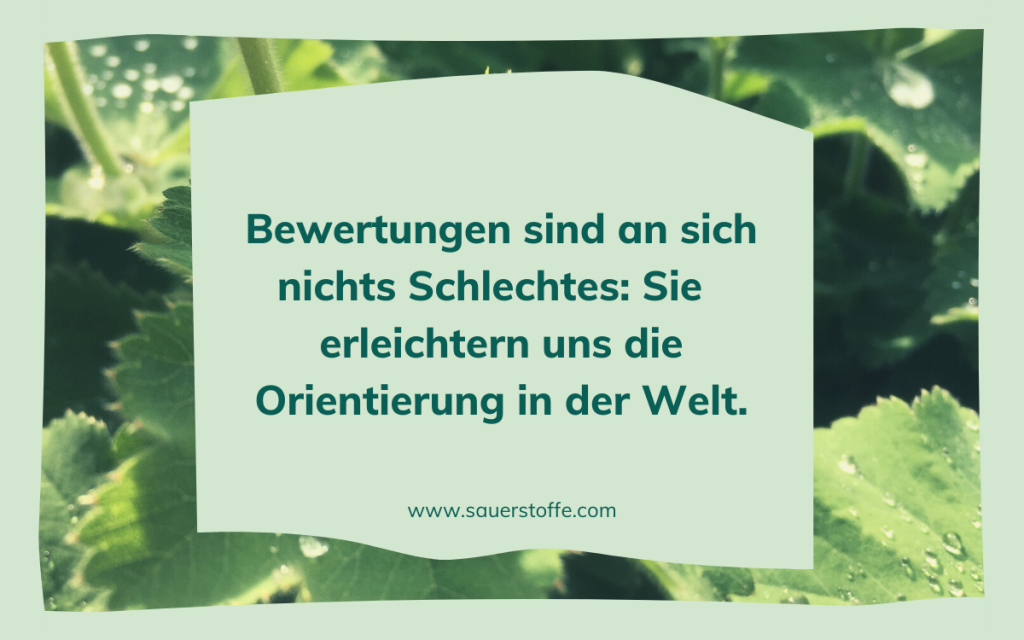
Stereotype können aber auch dazu führen, dass Menschen benachteiligt, beleidigt, falsch eingeschätzt und verletzt werden – sie prägen in hohem Maße unser Miteinander.
Es gibt Stereotype, die so verfestigt sind, dass viele sie gar nicht mehr hinterfragen: Bänker sind gierig; Frauen das „schwache Geschlecht“; Menschen, die Kevin heißen, sind Teil des Prekariats. Und, ganz neu: Sachsen sind aggressive Nazis. Je öfter solche Zuschreibungen wiederholt werden, desto mehr prägen sie sich ein. Das machen sich unter anderem Werbetreibende und Politiker zunutze: Sie verknüpfen ein zu verkaufendes Produkt mit Gefühlen oder erzeugen eindringliche (sprachliche) Bilder, die zu ihrer Agenda passen.
Nicht umsonst hantieren rechtspopulistische Parteien beispielsweise mit Begriffen, die an Naturgewalten erinnern, wenn sie über Migranten sprechen: die Worte „Flüchtlingswelle“ und „-strom“ verknüpfen sie gezielt mit dem Gefühl der Ohnmacht und Bedrohung; Not, Flucht vor Krieg und Schutzbedürfnis werden ausgeblendet.
Natürlich hängt unsere Wahrnehmung auch vom Kontext – zum Beispiel unserer Erziehung und Umgebung – ab. So verfestigen sich Stereotype vor allem bei denjenigen Menschen, die im Alltag keinen Kontakt mit der betreffenden Personengruppe haben. Bereits 1951 zeigten Forscher, dass Weiße, die in Gegenden der USA lebten, in denen auch schwarze Familien wohnten, deutlich weniger negative Vorurteile gegenüber Schwarzen hegten als Menschen aus Wohngegenden mit strikter Rassentrennung. Deshalb ist es auch so gefährlich, dass die Innenstädte immer homogener werden: die Reichen hier, die Einkommensschwachen dort. Die fehlende Begegnung im Alltag schafft Distanz – und führt zu Spott und Feindseligkeit gegenüber „den Anderen“.
Im Umkehrschluss heißt das: Begegnung hilft. Die Aktion „Deutschland spricht!“ der ZEIT, die in regelmäßigen Abständen viele Menschen mit unterschiedlichen Ansichten in ganz Deutschland ins Gespräch bringt, halte ich deshalb für einen guten Ansatz.
Ich finde, dass man viel mehr auf Gemeinsamkeiten statt Unterschiede zwischen den Menschen achten sollte. Letztendlich treiben uns alle dieselben Bedürfnisse um – sei es nach Anerkennung, Sicherheit, Erholung oder Respekt. Darum ist es so wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, bevor man vorschnell urteilt.
Das macht es auch leichter, den Mitmenschen zu verzeihen, wenn sie uns mal auf dem falschen Fuß erwischen.

Ist es dir auch schonmal passiert, dass du einen anderen Menschen völlig falsch eingeschätzt hast? Und wie hast du reagiert, als dir das klar wurde? ∞
Alles Liebe,

P.S.: Kennst du schon meinen Starter-Kompass „Klar & achtsam kommunizieren“? 