
Ich habe einen Vipassana-Kurs absolviert. Das bedeutet: zehn Tage für je zehn Stunden meditieren, ohne Kommunikation, ohne Handy, Musik oder Bücher. Es waren seeehr lange Tage – und zugleich sehr wertvolle Tage, in denen ich viel lernen durfte. Hier berichte ich dir von meinen Erkenntnissen.
Seit meinem Vipassana-Kurs 2018 hat sich viel in mir bewegt und verändert. Ein Update nach 5 Jahren findest du am Ende des Textes.
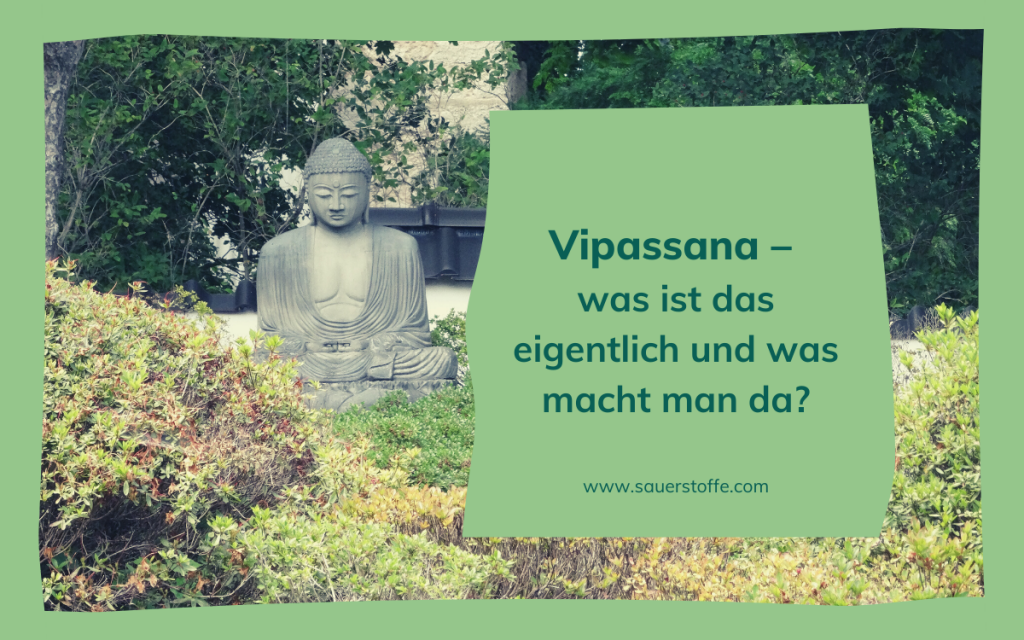
Vipassana ist eine uralte Meditationstechnik – und zwar die, so heißt es, mit der Buddha erleuchtet wurde. Das Pali-Wort “Vipassana” bedeutet “Einsicht“.
In der Vipassana-Praxis geht es darum, den Geist – der so oft in der Vergangenheit oder der Zukunft herumschwirrt – auf die Gegenwart zu fokussieren. Oder kurz gesagt: Achtsamkeit zu erlernen. Und es geht darum zu erkennen, dass wir selbst und die Welt um uns herum sich ständig verändern – und das achtsam und gleichmütig zu beobachten.
Es gibt Vipassana-Kurse und -Zentren überall auf der Welt. Jeder ist willkommen – die Vipassana-Praxis ist an keine Religionszugehörigkeit gebunden und wird auch von Nicht-Buddhisten ausgeübt. Die Kurse werden einzig und allein mit Spenden finanziert, sie sind also grundsätzlich kostenlos.
“Was wird, vergeht”, lautet ein Zitat von Buddha. Und ja: Alles verändert sich. In jeder Sekunde.
Wenn du diesen Text zuende gelesen hast, wirst du nicht mehr der Mensch sein, der du zu Beginn gewesen bist. Die Zellen deines Körpers arbeiten währenddessen auf Hochtouren, alles ist in Bewegung. Die Zeit vergeht, die Wolken ziehen weiter, Menschen gehen von A nach B, es wird in jeder Sekunde geackert, geredet, gestritten, gebaut, zerstört.
Und genauso sind weder unser Unglück noch unser Glück in Stein gemeißelt. Sie entstehen und vergehen, entstehen wieder und vergehen aufs Neue.
Bei der Vipassana-Meditation erfährt man das nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern unmittelbar anhand der Empfindungen des eigenen Körpers. Ich habe festgestellt, dass unangenehme Empfindungen wie Schmerz, Jucken oder Druck, aber auch angenehme Empfindungen wie Wärme und Entspannung immer wieder kommen und gehen. Und wieder kommen und gehen.
Unglück entsteht auf zweierlei Art. Erstens: Wenn wir eine unangenehme Empfindung oder ein unschönes Erlebnis haben, dann wollen wir, dass es aufhört. Wir kämpfen dagegen an und reagieren mit Ablehnung. Und zweitens: Wenn wir eine angenehme Empfindung verspüren, wenn uns etwas Schönes wiederfährt, dann wollen wir, dass das so bleibt. Wir klammern uns daran fest.
Beide Reaktionen – Ablehnung und Anklammern – sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie machen uns unzufrieden mit dem, was ist.
Beim Vipassana geht es darum, gleichmütig bleiben. Die Erkenntnis, dass sich die Dinge sowieso ständig verändern und es sich deshalb nicht lohnt, ablehnend oder anklammernd zu reagieren, kann wir unseren Stress erheblich reduzieren.
Wir entwickeln Gelassenheit gegenüber den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Denn alles geht einmal vorüber.
Unser Geist schwirrt ständig in zwei Sphären herum: der Vergangenheit und der Zukunft. In die Gegenwart, in den momentaten Augenblick, verirrt er sich hingegen nur selten. Und das kostet uns viel Energie: Wir sorgen uns um die Zukunft, wir hängen der Vergangenheit nach – und im Hier und Jetzt fühlen wir uns ausgeliefert, schwach und unbehaglich. Deshalb ist es wichtig, den Geist zu schulen.
Im Vipassana-Kurs nutzt man ein einfaches Mittel, um sich auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren: den Atem. Denn der fließt zu jeder Zeit im Hier und Jetzt – sogar unbewusst, wenn wir ihm keine Beachtung schenken oder wenn wir schlafen.
Wenn wir diesen natürlichen Anker nutzen, machen wir uns weniger Sorgen über die Zukunft, auf die wir keinen Einfluss haben und lassen die Vergangenheit los, die wir nicht mehr ändern können. Mir hilft zudem ein Gedanke sehr, um meinen Fokus auf die Gegenwart zu lenken: “Ich bin hier und alles ist jetzt”. (Ich habe ihn übernommen aus dem gleichnamigen, sehr empfehlenswerten Buch von Dr. Edith Eva Eger).

Das heißt nicht, dass ich nach zehn Tagen Vipassana plötzlich dauerhaft präsent bin. Aber ich werde mir schneller darüber bewusst, wenn mich in Sorgen oder Grübeleien verirre, und kann somit schneller Gegenmaßnahmen einleiten: Ein, aus. Ein – und aus. Ich bin hier und alles ist jetzt.
Genauso, wie wir keinen Einfluss auf die Vergangenheit und die Zukunft haben, bringt es nichts, sich den Kopf über das Verhalten anderer Menschen zu zerbrechen. Wir können es nicht ändern. Klar, wir können unser Gegenüber bitten, sich entsprechend unserer Erwartungen zu verhalten – ob es unserer Bitte nachkommt, liegt jedoch nicht in unserer Macht.
Erwartungen und Groll gegenüber anderen machen uns unglücklich. Es hilft uns mehr, wenn wir uns auf den einzigen Menschen konzentrieren, auf den wir tatsächlichen Einfluss haben: auf uns selbst. Wir können nicht die Menschen ändern, nur die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen und auf sie reagieren.
Denn kein Mensch tut etwas ohne Grund. Wenn jemand dich mit einer Äußerung oder seinem Verhalten verletzt, dann geht es ihm vermutlich gerade selbst nicht so gut – oder es geschieht ohne Absicht. Wenn wir jedoch ärgerlich reagieren und an diesem Ärger festhalten, ist das, als würden wir Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Es funktioniert nicht.
Wir tun uns deshalb einen großen Gefallen, wenn wir die Menschen sein lassen, wie sie sind – und uns auf darauf konzentrieren, selbst zu dem liebevollsten, umsichtigsten und großherzigsten Menschen zu werden, den wir kennen.
Eine wichtige Regel während eines Vipassana-Kurses ist die “edle Stille” (“noble silence”) während der ersten neun Tage. Das bedeutet: nicht reden, keine Gesten, kein Augen- und Körperkontakt mit den anderen Meditierenden – man soll das Gefühl entwickeln, allein, ganz für sich, zu arbeiten. Die edle Stille ist zu Beginn recht ungewohnt; zugleich empfand ich sie als sehr angenehm. Gedanken über Smalltalk-Themen oder Höflichkeitsfloskeln entfallen damit. Und die Ruhe verhindert, dass man abgelenkt wird (nicht mehr jedenfalls als von den eigenen Gedanken im Kopf).
Doch so sehr man sich auch bemüht – ganz ohne Kommunikation geht es nicht. Wir sprachen zwar nicht miteinander, kleine Höflichkeitsgesten blieben aber auch während der edlen Stille bestehen: die Tür einen Moment länger aufhalten, wenn jemand hinter einem läuft, einen Schritt am Kaffeeautomaten zurücktreten, um eine Mitmeditierende durchzulassen. Auch selbst einmal vorbeigelassen werden. Und einmal begann jemand während der Meditaion wild zu kichern, und der Frohsinn verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Halle – die Tage des ernsthaften Arbeitens entluden sich, so mein Gefühl, in diesem Moment bei vielen.

Komplette Nicht-Kommunikation ist also einfach nicht möglich, wo Menschen aufeinandertreffen. Wir sind einfach darauf gepolt, aufeinander zu achten. Zugleich fand ich es rührend, welche Wirkung solche kleinen, unterschwelligen Gesten entfalten können: Sie gaben mir das Gefühl, nicht allein zu sein – und damit positive Energie.
Während zehn Tagen in Stille kommt der Geist ganz schön in Fahrt. Mir fielen Dinge ein, die ich längst vergessen geglaubt hatte. Und ich spann sie weiter und weiter und wusste nach ein paar Minuten gar nicht mehr, wie ich dort hin gekommen war.
Ähnlich verhält sich der Geist in Bezug auf andere Menschen. Man bekommt einen Eindruck von einer Person, und zack – folgt eine Bewertung. Und zwar nicht anhand objektiver Kriterien, sondern anhand unserer persönlichen Vorlieben, unserer Erziehung und unseren früheren Erlebnissen. Denn wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sind.
So war es auch während des Kurses. Meine Mitmeditierenden wirkten zum Teil richtig grummelig und schlecht gelaunt – dabei waren sie einfach nur in sich versunken, so, wie es sein sollte. Und dennoch ging ich manchmal meinen Klischees und Vor-Urteilen auf den Leim und begann zu bewerten “übellaunig”, “traurig” etc. – oder ich sorgte mich, ob sie meinetwegen so schauten, was ich falsch gemacht haben könnte und so weiter.
Wenn man von etwas überzeugt ist – und nicht einmal etwas sagen oder nachfragen kann – ist der Geist erstaunlich gut darin, plausible Erklärungen für unsere persönlichen Eindrücke zu finden und sich komplett zu verrennen. Wie in Paul Watzlawicks “Geschichte mit dem Hammer”:
Darin will ein Mann ein Bild aufhängen, hat aber nur einen Nagel und beschließt deshalb, sich einen Hammer beim Nachbarn auszuborgen.
Doch dann kommt ihm ein Gedanke: “Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern hat er mich nur so flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er in Eile… aber vielleicht war das auch nur vorgetäuscht und er hat etwas gegen mich. Aber was? Ich habe ihm nichts getan; der bildet sich da etwas ein… Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Warum tut mein Nachbar nicht dasselbe? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie der Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat!”
Jetzt reicht es dem Mann und er stürmt hinüber, klingelt, der Nachbar öffnet, und noch bevor er „Guten Morgen“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren blöden Hammer, Sie Rüpel!“

So ist das manchmal mit unseren Gedankenspiralen, wenn wir unachtsam sind. Auch mir ging es so: Als die Stille dann aufgehoben war, ergab sich im Gespräch mit den anderen Teilnehmern nicht nur, dass ich meist mit meinen Einschätzungen weit daneben lag – es war auch interessant zu erfahren, dass viele ganz ähnliche Gedanken gehabt hatten.
Ich versuche versuche nun auch im Alltag nicht mehr so oft auf mein Kopfkino zu hören – denn meistens entpuppt es sich als falsch. Und unsere Gedanken über andere Menschen sagen oft viel mehr über uns selbst aus als über unser Gegenüber.
Das Leben im Vipassana-Zentrum ist abwechslungslos und zieht sich wie Kaugummi – das soll so sein, damit sich die Meditierenden einerseits ohne Ablenkung von Außen ihrer inneren Arbeit widmen können und andererseits, damit sie sich auch diesbezüglich darin üben können, gleichmütig zu bleiben. Die einzige Abwechslung waren die Runden, die wir während der Pausen durch den Gehbereich drehen konnten und die drei täglichen Mahlzeiten.
Das klingt nach ziemlich wenig – aber auf mich wirkte es nicht so. Ich schickte bei jedem Essen ein stilles “Danke” zum ehrenamtlichen Helferteam in der Küche und freute mich über jedes Mahl. Ebenso wie über den Anblick der Sonne und des blauen Himmels, des Vollmonds und der raureifbedeckten Blätter und Gräser bei meinen täglichen Runden in den Pausen zwischen den Meditationen.

Während der Zeit in Stille entdeckte ich Details und Kleinigkeiten, die mir sonst nicht aufgefallen wären und war dankbar für all die Fülle und Schönheit um mich herum. Das hilft mir hoffentlich auch in Zukunft, das Schöne im vermeintlich Tristen und Langweiligen zu erkennen – und dafür dankbar zu sein.
Vor meinem Vipassana-Kurs dachte ich: Einmal hingehen, zehn Tage sitzen und Innenschau betreiben, Kopf und Geist defragmentieren, und fertig.
In unserem leistungsorientierten Verständnis macht man einen Kurs, erhält ein Zertifikat und kann einen Haken hinter die Sache machen. Deshalb war ich erstmal erstaunt, dass es in unserer Gruppe zur gleichen Zahl sogenannte neue und alte Schüler gab. Viele kommen immer wieder, um zu meditieren oder bei den Kursen zu helfen, um die Stille zu nutzen und innerlich zu wachsen. Denn Achtsamkeit ist ein Prozess – und hört nicht einfach nach zehn Tagen auf.
Ich bin sehr dankbar für den Anfang, für die Zeit in der Stille und viele gute Erkenntnisse. Die wirkliche Herausforderung hat aber danach begonnen: all das in meinen Alltag zu integrieren und mich auch im “echten” Leben immer wieder darauf zurückzubesinnen.
Du hast nun viel über meine Vipassana-Erkenntnisse erfahren und denkst vielleicht, dass sich das alles ganz gut und richtig anhört. Oder dass es völliger Quatsch ist. Beides ist ok. Was mir guttut, muss nicht zwingend denselben Effekt auf jemand anderen haben – jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.
Selbsterkenntnis ist das Credo von Vipassana. In diesem Sinne wurden die hier geschilderten Erkenntnisse in den zehn Tagen nicht nur theoristisch vermittelt; ich habe sie unmittelbar am eigenen Körper erlebt.
Vielleicht ist so ein Kurs auch etwas für dich, vielleicht aber auch nicht. Die Suche nach deinem individuellen Weg kann ich dir nicht abnehmen. Du musst ihn selbst finden und gehen – im Vertrauen auf deine Intuition, deine innere Weisheit und deine Visionen.
Und auch, wenn ich deinen Weg nicht kenne – was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Finden des eigenen Wegs eine wunderschöne Sache ist. Ich wünsche dir alles Gute dabei. ∞
Alles Liebe,

P.S.: Kennst du schon meinen Starter-Kompass „Klar & achtsam kommunizieren“? 