
In Teil 3 der GFK-Serie geht es um eine zentrale Unterscheidung der gewaltfreien Kommunikation: Beobachten statt Bewerten. Unsere Gedanken können voller automatischer Urteile sein, die unsere Sicht verzerren und Missverständnisse fördern. Ich zeige dir, wie du diese Bewertungen erkennst, bewusst stoppst und stattdessen neutral beobachtest – für mehr Klarheit und echte Verbindung in Gesprächen.
Hier kannst du die passende Podcast-Folge anhören (erschienen am 19.11.2019):
🔗 Links zur Folge:
Vielleicht kennst du das auch: Jemand sagt oder tut etwas – und zack! – läuft innerlich sofort ein Film ab. Du ordnest das Erlebte ein, ziehst Schlüsse, bewertest – oft in Millisekunden, völlig automatisch.
Diese schnellen Einordnungen – die berühmten Schubladen in unserem Kopf – helfen uns im Alltag, indem sie vieles effizienter machen. Wir müssen zum Beispiel nicht jedes Mal wieder nachdenken, bevor wir die Straße überqueren. Dank unserer Erfahrungen wissen wir ganz automatisch: Erst schauen, ob ein Auto kommt oder die Ampel grün ist, dann losgehen.
Aber diese automatischen Einordnungen können uns auch auf die falsche Fährte führen. Denn nicht immer stimmen unsere Bewertungen (man könnte auch sagen: unsere vorschnellen Schlüsse) mit dem überein, was gerade tatsächlich passiert.
In der gewaltfreien Kommunikation geht es deshalb darum zu unterscheiden:
Was sehe oder höre ich tatsächlich? Und was interpretiere oder bewerte ich?
Bei der Frage nach Beobachtung oder Bewertung geht es also um die Frage: Was passiert wirklich – und was macht unser Kopf daraus?
Mir hilft da oft eine einfache Faustregel:
Was würde eine Kamera aufnehmen?
Wenn wir das, was passiert, wie eine Kamera beschreiben – also ohne Interpretation, ohne Mutmaßung, ohne Emotion – dann sind wir bei der Beobachtung.
Beispiel:
Beobachtung: Mein Kollege ging durch die Tür. Ich ging hinter ihm her. Die Tür fiel zu.
Bewertung: Er hat mich ignoriert, wie unhöflich.
Es ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied für unser Miteinander und inneres Erleben.
Unsere Bewertungsschubladen sind nicht per se schlecht. Sie helfen uns, den Alltag zu strukturieren, schnell zu reagieren, Muster zu erkennen. Aber sie bringen eben auch das Risiko mit sich, dass wir alte Geschichten auf neue Situationen projizieren.
Beispiel: Ich begegne jemandem und habe spontan ein schlechtes Gefühl. Vielleicht liegt das nicht an der Person selbst, sondern daran, dass sie mich an jemanden erinnert, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich sehe ihn durch meine persönliche Brille. Das läuft unbewusst ab – fühlt sich aber real an.
Hier bewusst innezuhalten und zu erkennen: Moment – das ist gerade eine Bewertung. Ich schau mir erst mal an, was wirklich passiert – das ist der erste Schritt raus aus der Schublade und hin zu einem bewussteren Umgang mit uns selbst und anderen.
Wichtig ist mir hier noch zu erwähnen, dass das ein Weg ist.
Unser gewohntes Verhalten können wir nicht von heute auf morgen komplett ändern – aber wir können wahrnehmen, dass sich unsere Muster trotzdem Schritt für Schritt wandeln, wenn wir sie einmal bemerkt haben und dranbleiben.
Ich stelle es mir gerne wie eine Zeitleiste vor: Am Anfang bemerke ich vielleicht erst Stunden nach einer Situation, dass es besser gewesen wäre, hier kurz innezuhalten und durchzuatmen, bevor ich reagiere.
Beim nächsten Mal bemerke ich es vielleicht schon kurz nach der Situation (immer noch zu spät, aber schon schneller) – und irgendwann kann ich direkt zum richtigen Zeitpunkt so reagieren, wie ich gerne würde (anstatt automatisch). Das fühlt sich dann vielleicht erstmal noch holprig und unsicher an und geht dann beim nächsten Mal schon besser.
Es wird also mit jedem Mal ein kleines bisschen einfacher, so zu handeln wie ich es gerne würde, bis es irgendwann klappt und ganz normal wird. (Und manchmal falle ich zwischendurch auch zurück ins alte Muster und versuche, das wohlwollend und verständnisvoll zu betrachten, so nach dem Motto: Ich übe es und beim Üben passieren nunmal auch Fehler).
Viktor Frankl hat das in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen so formuliert:
Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.
In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion.
In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.
Und genau darum geht es. Diesen Raum zwischen dem, was passiert, und dem, wie wir darauf reagieren, bewusst wahrzunehmen und zu Stück für Stück auszudehnen. Zum Beispiel mit einem tiefen Ein- und ausatmen. Nicht aus automatischen Mustern heraus zu handeln, sondern frei, bewusst und klar.
Oder anders formuliert:

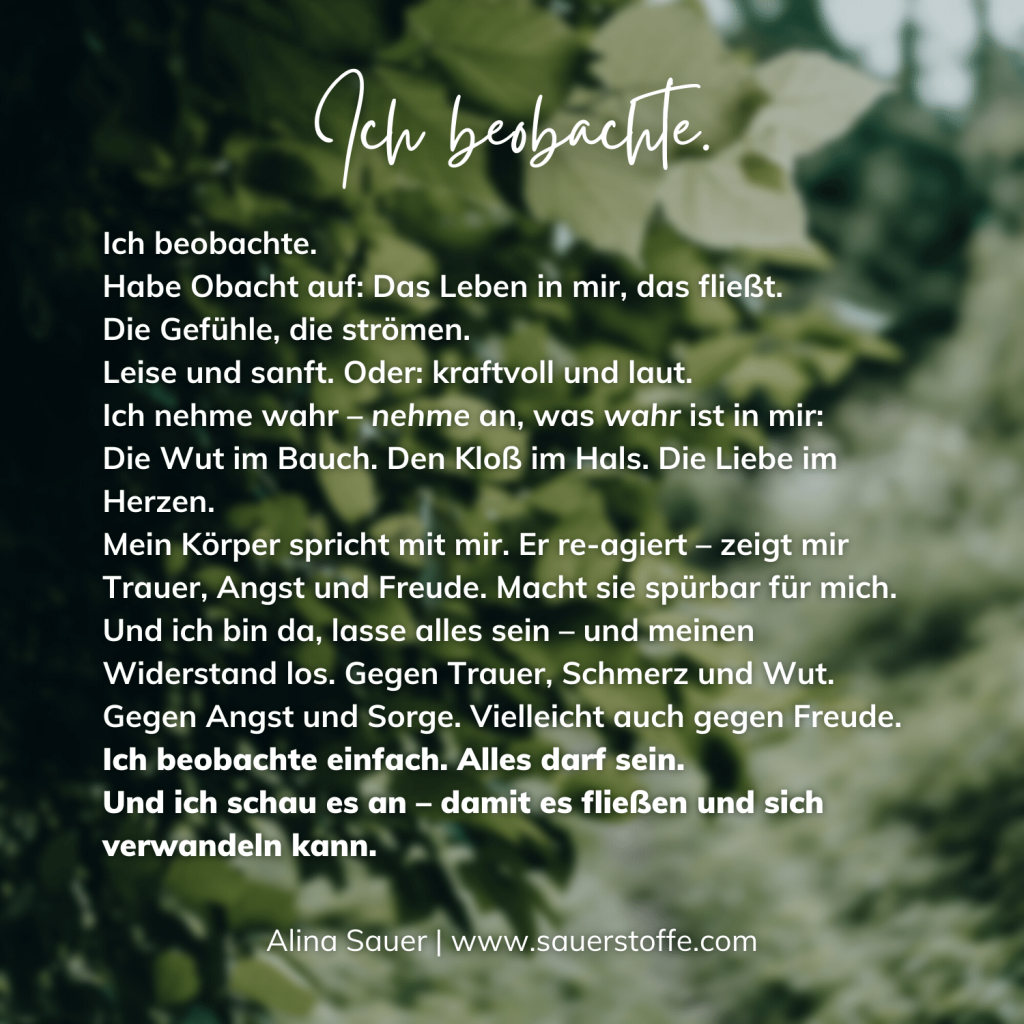
Fazit:
Die Kunst zu beobachten statt zu bewerten ist ein Schlüssel für ein entspannteres Miteinander. Und wie alles, was tiefgreifend wirkt, braucht es Übung – und Geduld. Aber es lohnt sich. Denn je öfter es uns gelingt, erst mal innezuhalten, bevor wir bewerten, desto klarer und friedlicher wird unsere Kommunikation – mit uns selbst und mit anderen.
Dies ist Teil 3/4 meiner Podcastreihe zu den Basics der Gewaltfreien Kommunikation. Zu den anderen Teilen geht’s hier:
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen