
— Update meines Erfahrungsberichts von 2018 —
2018 habe ich einen Vipassana-Kurs gemacht: Zehn Tage Schweigen, zehn Stunden täglich meditieren. Damals eine spannende Erfahrung für mich. Heute, mit mehr Wissen über unser Nervensystem und Trauma, ordne ich vieles davon anders ein. Hier teile ich beides: meine damaligen Erkenntnisse – und meine heutige Sicht darauf.
Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf meinem Blogartikel aus dem Jahr 2018 („10 Dinge, die ich in 10 Tagen Schweigen & Meditieren gelernt habe – Vipassana Erfahrungsbericht“) und wurde im Januar 2026 inhaltlich aktualisiert. Ergänzungen und neue Einordnungen aus heutiger, traumasensibler Sicht sind im Text gelb markiert und mit „Heutige Einordnung“ gekennzeichnet.
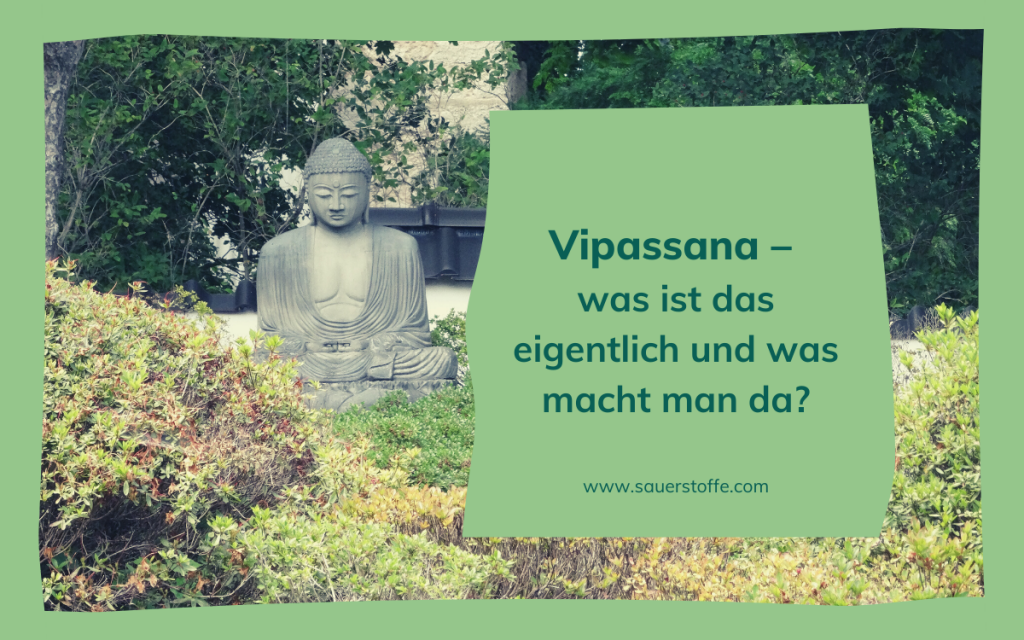
Die grafischen Einschübe im Text stammen aus meinem ursprünglichen Artikel von 2018 und spiegeln meine damalige Sicht wider.
Vipassana ist eine uralte Meditationstechnik – und zwar die, so heißt es, mit der Buddha erleuchtet wurde. Das Pali-Wort „Vipassana“ bedeutet „Einsicht“.
In der Vipassana-Praxis geht es darum, den Geist – der so oft in der Vergangenheit oder der Zukunft herumschwirrt – auf die Gegenwart zu fokussieren. Und es geht darum zu erkennen, dass wir selbst und die Welt um uns herum sich ständig verändern – und das achtsam und gleichmütig zu beobachten.
Es gibt Vipassana-Kurse und -Zentren überall auf der Welt. Die Kurse werden einzig und allein mit Spenden finanziert, sie sind also grundsätzlich kostenlos.
„Was wird, vergeht“, lautet ein Zitat von Buddha. Und ja: Alles verändert sich. In jeder Sekunde.
Wenn du diesen Text zuende gelesen hast, wirst du nicht mehr der Mensch sein, der du zu Beginn gewesen bist. Und genauso sind weder unser Unglück noch unser Glück in Stein gemeißelt. Sie entstehen und vergehen, entstehen wieder und vergehen aufs Neue.
Bei der Vipassana-Meditation erfährt man das nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern unmittelbar anhand der Empfindungen des eigenen Körpers. Ich habe festgestellt, dass unangenehme Empfindungen wie Schmerz, Jucken oder Druck, aber auch angenehme Empfindungen wie Wärme und Entspannung immer wieder kommen und gehen. Und wieder kommen und gehen.
Heutige Einordnung:
Damals hat mir die Idee, dass alles vergeht, geholfen. Heute weiß ich: Manche Empfindungen vergehen nicht allein durch das stille Hinschauen. Sie sind wie ungehörte Anteile in uns, die sich in einen dunklen Raum zurückgezogen haben. Sie verschwinden nicht, wenn wir sie ignorieren oder sie mit Disziplin „wegatmen“ wollen. Sie warten darauf, dass wir nicht nur zuschauen, sondern die Tür öffnen, das Licht anmachen und ihnen signalisieren: „Ich sehe dich. Ich bin da. Du bist hier sicher und ich höre dir zu.“
Echte Veränderung entsteht also nicht dadurch, dass wir Empfindungen bloß aushalten, sondern dadurch, dass wir uns ihnen in Sicherheit und Verbundenheit nähern, sie halten und behutsam „verdauen“.
Hinzu kommt aus meiner heutigen Sicht: In der heutigen Zeit ploppt bei vielen Menschen innerlich viel schneller viel mehr an die Oberfläche als noch vor einigen Jahren. Das Nervensystem steht bei vielen ohnehin unter Dauerstress. Intensive Settings wie lange Stille können dann Prozesse freilegen, für die unser inneres Fundament im Alltagstrubel manchmal noch nicht stabil genug ist. Deshalb würde ich heute deutlich vorsichtiger sein und solche Erfahrungen behutsamer und besser eingebettet angehen.
Unglück entsteht auf zweierlei Art. Erstens: Wenn wir eine unangenehme Empfindung oder ein unschönes Erlebnis haben, dann wollen wir, dass es aufhört. Wir kämpfen dagegen an und reagieren mit Ablehnung. Und zweitens: Wenn wir eine angenehme Empfindung verspüren, wenn uns etwas Schönes wiederfährt, dann wollen wir, dass das so bleibt. Wir klammern uns daran fest.
Beide Reaktionen – Ablehnung und Anklammern – sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie machen uns unzufrieden mit dem, was ist.
Beim Vipassana geht es darum, gleichmütig bleiben. Die Erkenntnis, dass sich die Dinge sowieso ständig verändern und es sich deshalb nicht lohnt, ablehnend oder anklammernd zu reagieren, kann wir unseren Stress erheblich reduzieren. Wir entwickeln Gelassenheit gegenüber den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Denn alles geht einmal vorüber.
Heutige Einordnung:
Früher dachte ich, Gleichmut sei das oberste Ziel. Heute merke ich: Oft fühlt sich Gleichmut nicht weit und befreiend an – sondern irgendwie leer. Wie eine Glasscheibe zwischen mir und dem Leben. Alles ist ruhig, nichts tut weh – aber es berührt mich auch nichts wirklich.
Aus traumasensibler Sicht ist das nicht falsch, sondern ein intelligenter Schutz. Wenn das Nervensystem überfordert ist, fährt es herunter. Wir wollen dann nichts mehr, fühlen uns gleichgültig, manchmal auch hilflos oder abgeschnitten.
Erst wenn der Körper wieder ein kleines bisschen Sicherheit spürt, kann sich dieser Schutz langsam lösen und wir beginnen aufzutauen. Und dann tauchen oft auch die eingefroerenen Gefühle wieder auf. Sie wollen dann nicht neutral beobachtet oder „weggeatmet“ werden. Sondern im Gegenteil: gehört, gehalten und Schritt für Schritt im Körper reguliert – in einem Tempo, das sich sicher anfühlt.
Unser Geist schwirrt ständig in zwei Sphären herum: der Vergangenheit und der Zukunft. In die Gegenwart, in den momentaten Augenblick, verirrt er sich hingegen nur selten. Und das kostet uns viel Energie: Wir sorgen uns um die Zukunft, wir hängen der Vergangenheit nach – und im Hier und Jetzt fühlen wir uns ausgeliefert, schwach und unbehaglich. Deshalb ist es wichtig, den Geist zu schulen.
Im Vipassana-Kurs nutzt man ein einfaches Mittel, um sich auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren: den Atem. Wenn wir diesen natürlichen Anker nutzen, machen wir uns weniger Sorgen über die Zukunft, auf die wir keinen Einfluss haben und lassen die Vergangenheit los, die wir nicht mehr ändern können.
Mir hilft zudem ein Gedanke sehr, um meinen Fokus auf die Gegenwart zu lenken: „Ich bin hier und alles ist jetzt“. (Ich habe ihn übernommen aus dem gleichnamigen, sehr empfehlenswerten Buch von Dr. Edith Eva Eger).

Das heißt nicht, dass ich nach zehn Tagen Vipassana plötzlich dauerhaft präsent bin. Aber ich werde mir schneller darüber bewusst, wenn mich in Sorgen oder Grübeleien verirre, und kann somit schneller Gegenmaßnahmen einleiten: Ein, aus. Ein – und aus. Ich bin hier und alles ist jetzt.
Heutige Einordnung:
Damals dachte ich, dass die Konzentration auf die Gegenwart ein wichtiges Heilmittel sei. Heute weiß ich: Traumatisierte Anteile stecken oft tief in der Vergangenheit und können das Hier und Jetzt gar nicht richtig wahrnehmen. Sie fühlen sich immer noch wie in den überfordernden Umständen von damals. Für sie ist Präsenz erst dann möglich, wenn sie sich sicher fühlen. Ohne diese Basis kann der Fokus auf den Atem Druck erzeugen statt Ruhe.
Präsenz entsteht nicht, wenn wir uns „zusammenreißen“, sondern wenn der Körper merkt: Hier droht keine Gefahr. Erst dann wird das Jetzt überhaupt zugänglich. Achtsamkeit und Atemfokus können hilfreich sein – aber nicht für alle.
Aus heutiger Sicht wird hier auch eine Grenze der Vipassana-Praxis sichtbar. Obwohl körperliche Empfindungen beobachtet werden, ist der Ansatz kaum körperorientiert im Sinne von Regulation: Bewegungsimpulse sollen unterdrückt werden, längeres unbewegtes Sitzen wird erwartet. Da sich ein gestresstes Nervensystem jedoch über Bewegung, Orientierung und äußeren Halt reguliert, kann genau diese Unbeweglichkeit zusätzlichen Stress oder sogar Erstarrung auslösen.
Aus traumasensibler Sicht beginnt das Hier und Jetzt deshalb oft ganz anders: über den Boden unter den Füßen, über das bewusste Umschauen im Raum, über etwas Stabiles außerhalb von uns. Ein Stuhl, der uns trägt. Eine stabile Wand im Rücken. Ein Gegenstand, der verlässlich da ist. Erst wenn der Körper diesen äußeren Halt spürt und merkt: „Ich bin sicher“, kann sich auch der Blick nach innen entspannen – und echte Präsenz wie von selbst entstehen.
Genauso, wie wir keinen Einfluss auf die Vergangenheit und die Zukunft haben, bringt es nichts, sich den Kopf über das Verhalten anderer Menschen zu zerbrechen. Wir können es nicht ändern. Klar, wir können unser Gegenüber bitten, sich entsprechend unserer Erwartungen zu verhalten – ob es unserer Bitte nachkommt, liegt jedoch nicht in unserer Macht.
Erwartungen und Groll gegenüber anderen machen uns unglücklich. Es hilft uns mehr, wenn wir uns auf den einzigen Menschen konzentrieren, auf den wir tatsächlichen Einfluss haben: auf uns selbst. Wir können nicht die Menschen ändern, nur die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen und auf sie reagieren.
Denn kein Mensch tut etwas ohne Grund. Wenn jemand dich mit einer Äußerung oder seinem Verhalten verletzt, dann geht es ihm vermutlich gerade selbst nicht so gut – oder es geschieht ohne Absicht. Wenn wir jedoch ärgerlich reagieren und an diesem Ärger festhalten, ist das, als würden wir Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Es funktioniert nicht.
Wir tun uns deshalb einen großen Gefallen, wenn wir die Menschen sein lassen, wie sie sind – und uns auf darauf konzentrieren, selbst zu dem liebevollsten, umsichtigsten und großherzigsten Menschen zu werden, den wir kennen.
Heutige Einordnung:
Zu glauben, dass alles nur in uns liegt, kann entlastend sein – aber auch einsam machen. Als müssten wir alles alleine schaffen: uns beruhigen, verstehen und heilen.
Heute weiß ich: Vieles von dem, was wir als „Muster“ oder „Überreaktionen“ erleben, ist in einer Zeit entstanden, in der wir auf andere Menschen angewiesen waren – oft sehr früh. Als Kinder konnten wir uns nicht selbst regulieren. Wir brauchten Bindung, Nähe, Spiegelung und Sicherheit von außen. Wenn das nicht ausreichend da war, hat unser Nervensystem Lösungen gefunden, um zu überleben.
Deshalb lassen sich diese Prägungen nicht einfach allein durch Rückzug oder reine Selbstregulation auflösen – auch wenn innere Helfer und Selbstkontakt viel bewirken können. Oft braucht es zunächst Beziehung: nachgeholte sichere Bindungserfahrungen, über die das Nervensystem lernt, dass es heute nicht mehr allein ist.
Heilung braucht Beziehung. Und manchmal auch etwas Größeres, an das wir uns anlehnen dürfen, wenn unsere eigene Kraft nicht reicht. Eine liebevolle, verlässliche Präsenz, die nicht bewertet und nichts fordert, sondern einfach hält – wie immer wir sie nennen. Sie kann den Halt geben, den wir vielleicht früher nicht hatten.
⚫⚫⚫
Wow, das war jetzt schon eine ganze Menge.
Vielleicht magst du an dieser Stelle eine kurze Pause machen, die Augen vom Bildschirm lösen, dich einmal in aller Ruhe in deinem Raum umschauen und ein paar bewusste Atemzüge fließen lassen?
⚫⚫⚫
Eine wichtige Regel während eines Vipassana-Kurses ist die „edle Stille“ („noble silence“) während der ersten neun Tage. Das bedeutet: nicht reden, keine Gesten, kein Augen- und Körperkontakt mit den anderen Meditierenden – man soll das Gefühl entwickeln, allein, ganz für sich, zu arbeiten. Die edle Stille ist zu Beginn recht ungewohnt; zugleich empfand ich sie als sehr angenehm. Gedanken über Smalltalk-Themen oder Höflichkeitsfloskeln entfallen damit. Und die Ruhe verhindert, dass man abgelenkt wird (nicht mehr jedenfalls als von den eigenen Gedanken im Kopf).
Doch so sehr man sich auch bemüht – ganz ohne Kommunikation geht es nicht. Wir sprachen zwar nicht miteinander, kleine Höflichkeitsgesten blieben aber auch während der edlen Stille bestehen: die Tür einen Moment länger aufhalten, wenn jemand hinter einem läuft, einen Schritt am Kaffeeautomaten zurücktreten, um eine Mitmeditierende durchzulassen. Auch selbst einmal vorbeigelassen werden. Und einmal begann jemand während der Meditaion wild zu kichern, und der Frohsinn verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Halle – die Tage des ernsthaften Arbeitens entluden sich, so mein Gefühl, in diesem Moment bei vielen.

Komplette Nicht-Kommunikation ist also einfach nicht möglich, wo Menschen aufeinandertreffen. Wir sind einfach darauf gepolt, aufeinander zu achten. Zugleich fand ich es rührend, welche Wirkung solche kleinen, unterschwelligen Gesten entfalten können: Sie gaben mir das Gefühl, nicht allein zu sein – und damit positive Energie.
Heutige Einordnung:
Schweigen wirkt nach außen ruhig – aber innerlich kann es ganz anders aussehen. Wenn früher niemand gefragt hat, wie es uns geht oder wir sogar mit Schweigen betraft wurden, kann tagelanges Nicht-Angesprochen-Werden genau dieses alte Gefühl wieder wachrufen: „Ich bin allein mit mir. Niemand sieht mich.“
Dass kleine Gesten im Kurs so tröstlich waren, zeigt, wie sehr unser Nervensystem auf Verbindung angewiesen ist – selbst (oder gerade) dann, wenn wir glauben, alleine „arbeiten“ zu müssen.
Während zehn Tagen in Stille kommt der Geist ganz schön in Fahrt. Mir fielen Dinge ein, die ich längst vergessen geglaubt hatte. Und ich spann sie weiter und weiter und wusste nach ein paar Minuten gar nicht mehr, wie ich dort hin gekommen war.
Ähnlich verhält sich der Geist in Bezug auf andere Menschen. Man bekommt einen Eindruck von einer Person, und zack – folgt eine Bewertung. Und zwar nicht anhand objektiver Kriterien, sondern anhand unserer persönlichen Vorlieben, unserer Erziehung und unseren früheren Erlebnissen.
So war es auch während des Kurses. Meine Mitmeditierenden wirkten zum Teil richtig grummelig und schlecht gelaunt – dabei waren sie einfach nur in sich versunken, so, wie es sein sollte. Und dennoch ging ich manchmal meinen Klischees und Vor-Urteilen auf den Leim und begann zu bewerten „übellaunig“, „traurig“ etc. – oder ich sorgte mich, ob sie meinetwegen so schauten, was ich falsch gemacht haben könnte und so weiter.
Wenn man von etwas überzeugt ist – und nicht einmal etwas sagen oder nachfragen kann – ist der Geist erstaunlich gut darin, plausible Erklärungen für unsere persönlichen Eindrücke zu finden und sich komplett zu verrennen. Wie in Paul Watzlawicks „Geschichte mit dem Hammer“:
Darin will ein Mann ein Bild aufhängen, hat aber nur einen Nagel und beschließt deshalb, sich einen Hammer beim Nachbarn auszuborgen.
Doch dann kommt ihm ein Gedanke: „Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern hat er mich nur so flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er in Eile… aber vielleicht war das auch nur vorgetäuscht und er hat etwas gegen mich. Aber was? Ich habe ihm nichts getan; der bildet sich da etwas ein… Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Warum tut mein Nachbar nicht dasselbe? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie der Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat!“
Jetzt reicht es dem Mann und er stürmt hinüber, klingelt, der Nachbar öffnet, und noch bevor er „Guten Morgen“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren blöden Hammer, Sie Rüpel!“

So ist das manchmal mit unseren Gedankenspiralen, wenn wir unachtsam sind. Auch mir ging es so: Als die Stille dann aufgehoben war, ergab sich im Gespräch mit den anderen Teilnehmern nicht nur, dass ich meist mit meinen Einschätzungen weit daneben lag – es war auch interessant zu erfahren, dass viele ganz ähnliche Gedanken gehabt hatten.
Ich versuche versuche nun auch im Alltag nicht mehr so oft auf mein Kopfkino zu hören – denn meistens entpuppt es sich als falsch. Und unsere Gedanken über andere Menschen sagen oft viel mehr über uns selbst aus als über unser Gegenüber.
Heutige Einordnung:
Heute sehe ich diese „Stimmen“ nicht mehr nur als Gedanken, sondern auch als innere Anteile. Manche davon sind sehr jung. Sie lassen sich nicht wegbeobachten wie Wolken am Himmel. Sie brauchen etwas anderes: Zuwendung. Orientierung. Manchmal ein inneres „Du musst das gerade nicht alleine schaffen.“
Gleichzeitig ist nicht alles, was in uns spricht, automatisch ein Anteil, der integriert werden will. Manche inneren Stimmen entstehen aus Angst, Überforderung oder alten Prägungen – und verlieren an Kraft, wenn unsere Sicherheit wächst. Traumaheilung entzieht diesen dunklen, verunsichernden Stimmen nach und nach den Boden, statt sich endlos mit ihnen zu beschäftigen.
Vipassana lädt zum neutralen Beobachten ein – traumasensible Arbeit ergänzt das durch Beziehung, Schutz und innere Ausrichtung.
Das Leben im Vipassana-Zentrum ist abwechslungslos und zieht sich wie Kaugummi – das soll so sein, damit sich die Meditierenden einerseits ohne Ablenkung von Außen ihrer inneren Arbeit widmen können und andererseits, damit sie sich auch diesbezüglich darin üben können, gleichmütig zu bleiben. Die einzige Abwechslung waren die Runden, die wir während der Pausen durch den Gehbereich drehen konnten und die drei täglichen Mahlzeiten.
Das klingt nach ziemlich wenig – aber auf mich wirkte es nicht so. Ich schickte bei jedem Essen ein stilles „Danke“ zum ehrenamtlichen Helferteam in der Küche und freute mich über jedes Mahl. Ebenso wie über den Anblick der Sonne und des blauen Himmels, des Vollmonds und der raureifbedeckten Blätter und Gräser bei meinen täglichen Runden in den Pausen zwischen den Meditationen.

Während der Zeit in Stille entdeckte ich Details und Kleinigkeiten, die mir sonst nicht aufgefallen wären und war dankbar für all die Fülle und Schönheit um mich herum. Das hilft mir hoffentlich auch in Zukunft, das Schöne im vermeintlich Tristen und Langweiligen zu erkennen – und dafür dankbar zu sein.
Heutige Einordnung:
Dankbarkeit kann eine wunderschöne Erfahrung sein – und zugleich eine Art Rettungsanker, um Stress auszuhalten. Heute unterscheide ich feiner: Entsteht Dankbarkeit aus Weite und innerer Ruhe – oder aus dem Versuch, mich zusammenzureißen und an etwas Schönem festzuklammern? Beides ist menschlich. Aber nur eines fühlt sich wirklich frei an.
Vor meinem Vipassana-Kurs dachte ich: Einmal hingehen, zehn Tage sitzen und Innenschau betreiben, Kopf und Geist defragmentieren, und fertig.
In unserem leistungsorientierten Verständnis macht man einen Kurs, erhält ein Zertifikat und kann einen Haken hinter die Sache machen. Deshalb war ich erstmal erstaunt, dass es in unserer Gruppe zur gleichen Zahl sogenannte neue und alte Schüler gab. Viele kommen immer wieder, um zu meditieren oder bei den Kursen zu helfen, um die Stille zu nutzen und innerlich zu wachsen. Denn Achtsamkeit ist ein Prozess – und hört nicht einfach nach zehn Tagen auf.
Ich bin sehr dankbar für den Anfang, für die Zeit in der Stille und viele gute Erkenntnisse. Die wirkliche Herausforderung hat aber danach begonnen: all das in meinen Alltag zu integrieren und mich auch im „echten“ Leben immer wieder darauf zurückzubesinnen.
Heutige Einordnung:
Rückblickend muss ich ehrlich sagen: Der große Achtsamkeitseffekt hielt bei mir nicht lange an. Nach ein paar Tagen im Alltag war vieles wieder wie vorher. Heute ziehe ich daraus einen anderen Schluss: Lieber langsamer, kleinschrittiger und dafür nachhaltig arbeiten – statt in kurzer Zeit sehr viel anzustoßen, das sich dann nicht wirklich verkörpert.
Heute würde ich sagen: Die wahre Arbeit beginnt dort, wo wir mit unserem Nervensystem wieder in Beziehung gehen. Nicht neutral, schweigend und allein, sondern in Verbindung mit anderen – und unserem Schmerz.
Du hast nun viel über meine Vipassana-Erkenntnisse erfahren und denkst vielleicht, dass sich das alles ganz gut und richtig anhört. Oder dass es völliger Quatsch ist. Beides ist ok. Was mir guttut, muss nicht zwingend denselben Effekt auf jemand anderen haben – jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.
Selbsterkenntnis ist das Credo von Vipassana. In diesem Sinne wurden die hier geschilderten Erkenntnisse in den zehn Tagen nicht nur theoristisch vermittelt; ich habe sie unmittelbar am eigenen Körper erlebt.
Vielleicht ist so ein Kurs auch etwas für dich, vielleicht aber auch nicht. Die Suche nach deinem individuellen Weg kann ich dir nicht abnehmen. Du musst ihn selbst finden und gehen – im Vertrauen auf deine Intuition, deine innere Weisheit und deine Visionen.
Heutige Einordnung:
Ja, Erfahrung ist wichtig. Aber ohne sicheren Rahmen kann sie retraumatisierend wirken. Heute weiß ich: Heilung und Entwicklung geschehen, wenn wir uns sicher fühlen. Ein Körper, der angespannt ist oder alten Stress gespeichert hat, braucht nicht mehr Einsicht, sondern Halt.
Manche Erfahrungen entfalten sich nur in dieser Sicherheit. Deshalb sollten sie in Räumen stattfinden, die Sicherheit priorisieren: wo wir immer wieder in die Gegenwart zurückkehren können, die Augen öffnen und uns umschauen, und wo es ein Gegenüber gibt, dem wir mitteilen dürfen, was in uns passiert. Nur so kann echte innere Arbeit geschehen..
Was mir damals ebenfalls nicht bewusst war, ist der sehr begrenzte Rahmen an Begleitung während eines Vipassana-Kurses. Nur in akuten Ausnahmefällen konnte man sich an jemanden wenden und das Schweigen brechen – und auch dann bestand die Rückmeldung meist darin, einfach weiterzumachen und der Praxis zu vertrauen, wie mir damals von anderen Meditierenden berichtet wurde. Aus heutiger Sicht empfinde ich diesen Umgang mit intensiven inneren Zuständen als zumindest unzureichend begleitet.
Ich bereue meine Vipassana-Erfahrung nicht. Und ich meditiere auch heute noch – aber nicht mehr möglichst kerzengerade und unbewegt, sondern in freundlichem Kontakt mit meinem Körper. Denn ich glaube nicht mehr daran, dass innere Entwicklung durch Disziplin und „da muss man halt durch“ entsteht. Veränderung passiert dort, wo der Körper und unser ganzes Wesen aufatmen kann. Wo wir spüren: „Ich bin sicher. Ich werde gehalten. Ich darf so sein, wie ich bin.“
Aus genau dieser Haltung heraus arbeite ich heute traumasensibel mit Menschen. In meinen Coachingräumen geht es nicht darum, sich zu optimieren oder noch besser zu funktionieren, sondern darum, wieder in Kontakt zu kommen – mit dem eigenen Körper, den eigenen Grenzen und dem eigenen Tempo.
Wir arbeiten körperorientiert und folgen den natürlichen Impulsen des Nervensystems. Nicht mit Druck, sondern mit Neugier. Nicht mit Durchhalten, sondern mit Zuhören. So können innere Konflikte sich sortieren, das System zur Ruhe kommen und alte Stressreaktionen Schritt für Schritt verdaut werden.
Manchmal zeigen sich dabei auch jüngere innere Anteile. Sie dürfen erleben, wie es sich anfühlt, willkommen zu sein, nicht funktionieren zu müssen und trotzdem dazuzugehören. Ich bin überzeugt, dass echte Veränderung in dieser Sicherheit entsteht – nicht über Nacht, aber dafür verkörpert und nachhaltig.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen