
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein kraftvolles Werkzeug, um schwierige Konflikte zu lösen und Beziehungen zu stärken. In der finalen 4. Folge meiner GFK-Serie fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und widme mich dem letzten Baustein: der Bitte. Außerdem beleuchte ich, wie Eigenverantwortung unsere Sprache klarer und achtsamer macht.
Hier kannst du die Folge anhören (erschienen am 26.11.2019):
🔗 Link zur Folge: Hier geht’s zum kostenlosen Starter-Kompass „Klar und achtsam kommunizieren“.
Bevor wir uns der Bitte widmen, lohnt sich ein kurzer Blick zurück.
GFK beginnt damit, dass wir beobachten, was tatsächlich passiert, ohne zu bewerten.
Dann benennen wir unsere Gefühle – sie sind die Sprache unserer Bedürfnisse.
Im dritten Schritt erkennen wir unsere Bedürfnisse als das, was uns antreibt und motiviert. Sie sind die Grundlage für echte Verbindung – mit uns selbst und anderen.
Diese drei Aspekte – Bedürfnisse kennen, Gefühle wahrnehmen und bewusst beobachten – bilden die Basis der gewaltfreien Kommunikation und schaffen Bewusstsein für unser Innenleben.
Und jetzt zum vierten Schritt: die Bitte. Sie ist die Verbindung nach außen, mit der wir auf andere zugehen. Die Bitte ist das Tüpfelchen auf dem i, das sichtbar macht, was wir unter der Oberfläche reflektiert und erkannt haben.
Es geht bei der Bitte darum, konkret und klar auszudrücken, was wir uns wünschen, ohne dabei Forderungen zu stellen.
Eine gute Bitte in der gewaltfreien Kommunikation hat folgende Eigenschaften:
Beim letzten. Punkt – der Verhandelbarkeit – liegt oft der Knackpunkt. Viele Bitten sind in Wahrheit Forderungen oder gar Drohungen nach dem Motto: „Wenn du nicht …, dann…“ – das setzt das Gegenüber unter Druck und lässt ihm keinen Raum, selbst zu entscheiden.
Eine echte Bitte schafft Raum für die freie Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen.
Denn niemand außer uns selbst ist verantwortlich für unsere Gefühle und Bedürfnisse:
Niemand „macht“ uns wütend oder traurig – diese Gefühle entstehen in uns selbst.
Und niemand außer uns selbst ist für die Erfüllung unserer Bedürfnisse verantwortlich.
Wir selbst tragen die Verantwortung, wie wir (auch auf ein Nein) reagieren und kommunizieren.
Oder als Gedicht ausgedrückt:

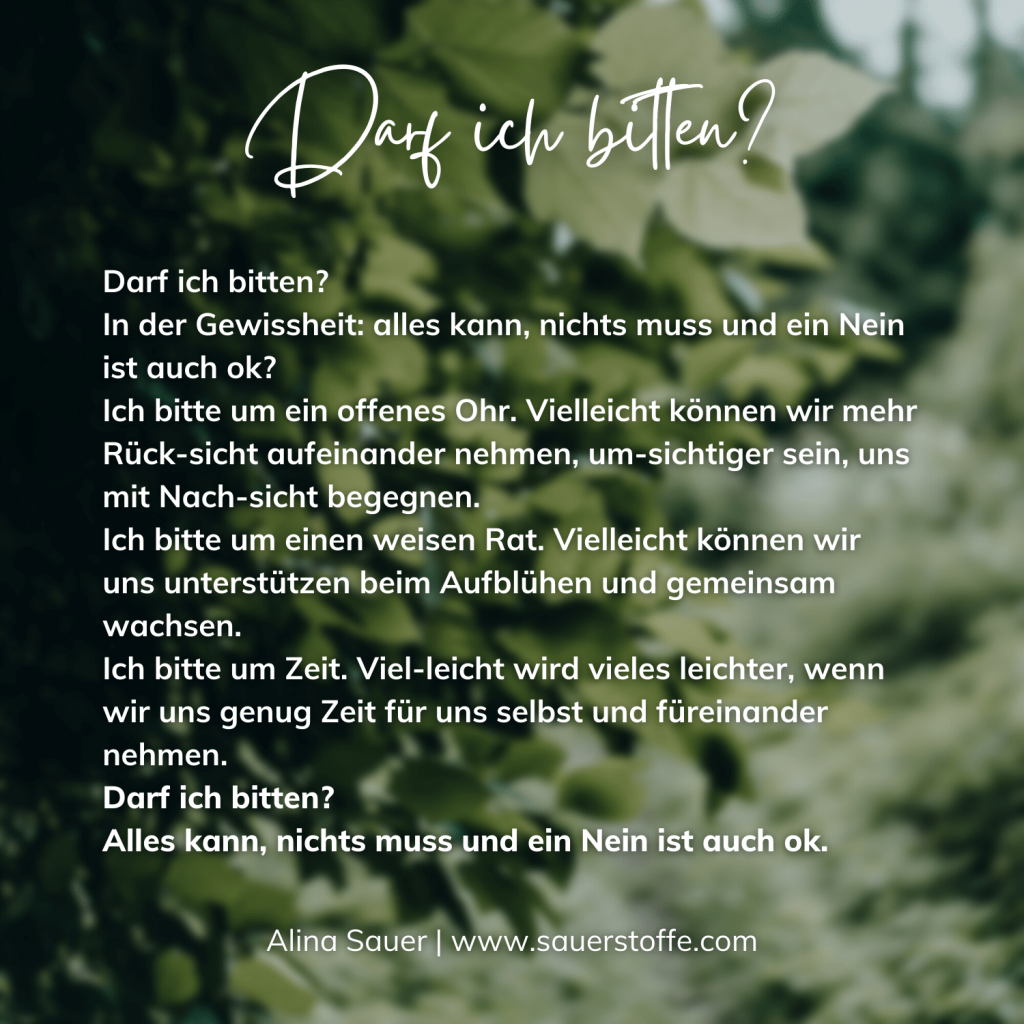
Gewaltfreie Kommunikation ist mehr als nur eine Methode – sie ist ein Prozess der Selbstreflexion und bewussten Begegnung. Indem wir unsere Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse klar wahrnehmen und in eine achtsame Bitte übersetzen, schaffen wir Raum für echte Begegnung und Veränderung.
So schließt sich der Kreis der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Sie helfen uns, achtsamer mit uns selbst und anderen umzugehen – mit mehr Klarheit, Verantwortung und Verbindung.
Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und Verfeinern dieser Fähigkeiten!
Dies ist Teil 4/4 meiner Podcastreihe zu den Basics der Gewaltfreien Kommunikation. Zu den anderen Teilen geht’s hier:
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen